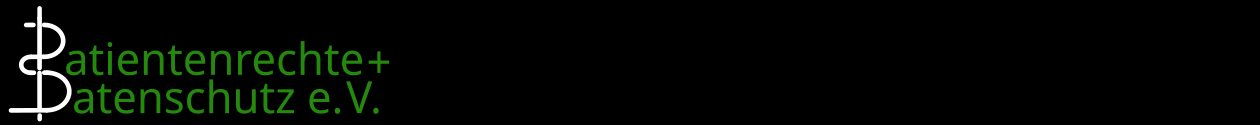Am 25.09.2017, unmittelbar nach der Bundestagswahl hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zwei Stellungnahmen veröffentlicht mit den Titeln
– Positionen der KBV zur Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung
– Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte.
Am 27.09.2017 wurde zudem der Letter of Intent zur Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen digitalen Agenda, eine gemeinsame Stellungnahme der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) und der KBV veröffentlicht.
Erkennbar versucht die KBV, mit diesen Stellungnahmen auf die in den Wochen vor der Wahl erneut aufgebrochene Diskussion um die Zukunft der elektronischen Gesundheitskarte (eGk) und die Zukunft der gematik zu reagieren und auf die Inhalte der Koalitionsvereinbarung im Bund Einfluss zu nehmen.
Für alle gesetzlich Versicherten, denen an Patientenrechten und Datenschutz gelegen ist, ein Anlass, um diese Stellungnahmen einer Überprüfung zu unterziehen. Die Positionen der KBV zu Digitalisierung im Gesundheitswesen und ePatientenakte weiterlesen