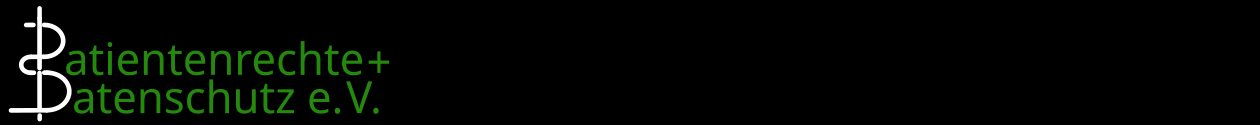Achtung! Der nachfolgende Beitrag enthält Ironie, Vulgärvokabular sowie Spuren von Wahrheit. Vermeiden Sie Überempfindlichkeitsreaktionen, indem Sie ihn nicht lesen!
Die Techniker Krankenkasse (TK) hat einen Vorschlag – und nun hat sich auch noch der stellvertretende Vorstandvorsitzende der TK im Ärzteblatt dazu geäußert. So viel Fleiß darf nicht unbelohnt – äh, unkommentiert – bleiben, daher hier die Highlights:
„Die Verfahren zur Regulierung sind hochkomplex und bergen das Risiko, Innovationen frühzeitig auszubremsen“, erläuterte Thomas Ballast, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TK…
Jawoll, Herr Ballast, da haben Sie sowas von Recht – Ausbremsen, das geht auf der Datenautobahn ja mal gar nicht! Das fällt eindeutig unter Nötigung und Verkehrsbehinderung!
So komplexe Regulierungsverfahren können ja auch nur unterbeschäftigten Bürokraten einfallen – die reden da von Datensicherheit und Einhaltung von Patientenrechten, haben die sonst keine Hobbies? Sowieso ist es komplett unverständlich, wieso nicht jeder Datenfrickler possierliche kleine „Fahrzeuge“ auf die Bundes-Gesundheitsdatenautobahn setzen sollte. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft – und wie man an der Formel 1 gut erkennen kann, werden die Fahrzeuge dabei immer schneller. (Und dann brauchen wir die Hyperraum-Umgehungstrasse…)
Überhaupt greift Ihre Forderung viiiel zu kurz: nicht nur für digitale, sondern für alle Gesundheitsprodukte müsste die Regulierung entkomplexifiziert werden! (Dann bekäme ich endlich eine offizielle Zulassung für meine Super-Heilelixiere, die helfen wirklich gegen alles – nur an den zu komplexen Verfahren sind sie bisher gescheitert. Studien über die Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen und so einen Kram – sowas vorzuschreiben, bremst ja nun wirklich jegliche Innovation aus!1!!)
Naja, zurück zur TK: Weil das mit dem Ausbremsen also gar nicht geht, hat sich die TK jetzt was ausgedacht, um allen so richtig Feuer unterm Arsch zu machen – nämlich das „Innovationsbudget“. Eine Supersache! Vor allem, weil das gar kein Budget ist, wo man sich an blöde Begrenzungen halten müsste – nein, es ist eine Untergrenze von 2,50 € pro Versichertem (mehr geht immer), die die Krankenkassen für „neue Versorgungsformen“ ausgeben müssen. Und wenn eine das nicht pünktlich schafft, dann werden ihre 2,50 € pro Kopf auf die schnelleren Krankenkassen umverteilt.
„Mit dem Innovationsbudget wollen wir ein wirkungsvolles Wettbewerbsinstrument im Gesundheitswesen installieren, das einen Suchprozess um die beste innovative Versorgung in Gang setzt“, erklärte Ballast.
Na, da können Sie einen drauf lassen, dass da hektische Suchprozesse in Gang kommen! Bevor es Minus-Budget gibt, wird auch das blindeste Huhn noch ein Innovations-Körnchen ausgraben – und dank Entkomplexifizierung auch zugelassen bekommen. Ein echtes Erfolgsrezept!
Oh, und eine schöne Studie, die ihren Standpunkt untergräbt – ach was, untermauert – hat die TK auch: https://www.tk.de/tk/themen/versorgung/iges-studie-2016/936410
Das haben viele kluge Leute geschrieben und die meinen: Digitale Innovation ist unsere Chance! Mehr davon! Nur bei der Regulierung wirds schon wieder komplex – maximal verkürzt sagt die Studie dazu: Digitale Produkte, die medizinische Daten (allgemeine oder individuelle) sammeln und darstellen, brauchen keine Regulierung – solche, die Diagnosen oder Therapien vorschlagen (dem Arzt oder als Arzt-Ersatz gleich dem Patienten) brauchen eine strenge Prüfung und Zulassungsregelung. (Na, das ist doch mal Science Fiction! Vergesst Star Trek, menschliche Ärzte sind von gestern!1!) Die TK schafft es aber, das Ergebnis nochmal grandios zu entkompli… entkomplexi… ach egal, sagen wir einfach „einzudampfen“ in: Das deutsche Gesundheitswesen braucht einen Innovationsschub.
Na, diesen Schub finanzieren wir doch gerne! Volle Schubkraft voraus! Warp-Antrieb ein!!! Was ist schon der ein oder andere Zusatzbeitrag auf dem Weg in eine derart galaktische Zukunft? 2,50 € bei etwa 70 Mio. Versicherten sind ja auch bloß schlappe 175 Mio. €. Für notleidende eHealth-StartUps ist das gerade mal ein Trostpflaster! Da langt unser Verkehrs- und Zukunfts(!)minister Dobrindt schon ganz anders hin und hilft seiner Klientel zügig aus der Patsche: Ein Fonds zur Entwicklung „intelligenter Verkehrsysteme“ in Städten schwebt ihm vor, damit dort Diesel-Fahrzeuge fröhlich weiter qualmen können. Das ist Zukunftsorientierung! Die Hälfte von der Kohle für die intelligente Verkehrsregelung, 250 Mio. €, sollen übrigens die Steuerzahler aushusten. Da geht also noch was, Herr Ballast von der TK, denken Sie in größeren Dimensionen – mehr so interstellar!
Und nehmen Sie ruhig meine Daten für Ihre digitalen Experimente… oder ne, warten Sie – vorher sollten wir uns noch kurz über die Zulassung und Kostenerstattung für meine Elixiere… Was heißt da „Nein“, Herr Ballast?! Sie Krämerseele haben aber auch gar keinen Sinn für echte Innovation!!1!!1!