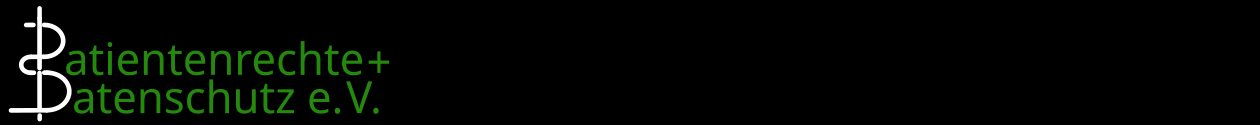In den letzten Tagen erschienen viele Berichte über elektronische Patientenakten mit „falschen oder übertriebenen Diagnosen“, ein gutes Beispiel dafür ist dieser Bericht des WDR. Diagnosen, von denen die Patient:innen nichts wussten, über die sie mit ihrer Ärzt:in nie geredet hatten, stehen vor allem in ihren sogenannten Abrechnungsdaten. Die Abrechnungsdaten sind Kopien der Abrechnungen, die Ärzt:innen einmal im Quartal an die Krankenkasse schicken. Sie werden normalerweise in die elektronische Patientenakte (ePA) aufgenommen.
Diese Abrechnungen sind Grundlage für die Bezahlung der einzelnen Ärzt:innen; sie sind auch eine Grundlage für die Verteilung der Versicherungsbeiträge zwischen den Krankenkassen mit dem Risiko-Strukturausgleich. Kurz gefasst: Je schlimmer eine Diagnose, desto mehr Geld gibt es unter Umständen für die Ärzt:in und für die Krankenkasse. Ausserdem: bestimmte Medikamente, oder das Verordnen von Physiotherapie muss mit „schlimmen“ Diagnosen gerechtfertigt werden, sonst drohen Regress-Forderungen. Es gibt also Anreize zum sog. „upcoding“, d.h. dazu, einen Behandlungsfall höher einzustufen. Zum Beispiel riefen Krankenkassen Ärzt:innen manchmal systematisch an, um sie zum upcoding zu veranlassen. Oder die Ärztesoftware, in der die Ärzt:nnen ihre Daten eingeben, weist automatisch auf notwendiges oder mögliches upcoding hin. Eine Möglichkeit des upcoding ist zum Beispiel, ein psychisches Problem mit zu erfassen, das ja die Grundlage einer körperlichen Krankheit sein kann.
Warum das upcoding für Patient:innen zum Problem werden kann
Wenn jemand eine Berunfsunfähigkeits-Versicherung abschließen möchte, oder von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln möchte, muss diese Person alle Krankheiten und Behandlungen der letzten 5 Jahre angeben. Ausserdem muss sie ihre behandelnden Ärzt:innen angeben und sie von ihrer Schweigepflicht entbinden (gegenüber der Privaten Krankenversicherung). Wenn diese Person nun eine elektronische Patientenakte (ePA) hat, werden die von der Versicherung befragten Ärzt:innen genötigt, dort nachzusehen, und die Inhalte an die Versicherung weiter zu geben. Bei Nicht-Weitergabe könnte die Versicherung später Leistungen verweigern. Die ePA, die bekanntlich von 80 % der Versicherten gar nicht genutzt wird, wird dadurch plötzlich zum Problem, zum „Beweis“ für Krankheiten, von denen die Patient:in gar nichts wusste.
Das ist ein Beispiel für eine Kritik an der ePA, nämlich: dass damit Diagnosen und Symptome aus dem Kontext gerissen werden, in dem die Informationen entstanden sind, und sie dadurch eine völlig andere und falsche Bedeutung bekommen. Das gilt besonders für die Abrechnungsdaten. Diese dienen im System bisher ausschließlich zur Abrechnung und haben mit medizinischer Tätigkeit ansonsten nichts zu tun.
Was man tun kann
Das Einfachste, was jede Bürger:in machen kann, ist, mit einem Widerspruch gegenüber der Krankenkasse zu verhindern, dass man eine ePA bekommt, und die bestehende ePA löschen zu lassen. Man kann auch nur die Abrechnungsdaten aus der ePA löschen lassen. Bevor man eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abschließt, oder bevor man zu den Privaten wechselt, sollte man das vorsichtshalber tun. Oder zumindest rechtzeitig nachsehen, was da drin steht. Damit keine Widersprüche auftauchen zwischen den eigenen Angaben im Versicherungs-Antrag, und der Auskunft der Ärzt:in, die von der Versicherung eingeholt wird. Man kann ggf. auch die Ärzt:in bitten, die „falschen“ Diagnosen zu ändern.
Politisch wäre es wünschenswert, die Abrechnungsdaten aus der ePA heraus zu nehmen. Das müsste auch für ePA Befürworter:innen akzeptabel sein, denn die Abrechnungsdaten werden ja über einen anderen Weg – direkt von den Krankenkassen – ohnehin an das Forschungsdatenzentrum geliefert. Sie stehen also der Forschung zur Verfügung, egal ob sie in der ePA stehen, oder nicht. Die Abrechnungsdaten in der ePA verhindern eine sinnvolle Zugriffsverwaltung für medizinische Informationen in der ePA. Aus technischen Gründen könnte, innerhalb der Abrechnungsdaten, nur äußerst schwierig eine Möglichkeit der Teil-Sperrung eingeführt werden. Jede Person, die überhaupt Zugriff darauf hat, sieht alles! Damit wird das ganze Konzept der ePA-Berechtigungsverwaltung ausgehebelt.
Unserer Meinung nach ist auch das Vergütungssystem krank, das für das upcoding so viele Anreize enthält. Das zu ändern, wird schwierig. Etliche Interessenvertretungen von Patient:innen und Ärzt:innen, wie attac oder der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte sind schon seit langem dafür.