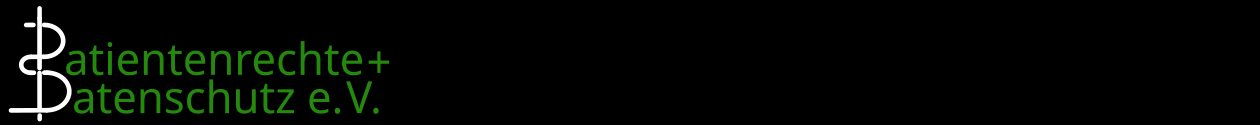Der Bertelsmann-Konzern ist durch seine Firma „Arvato Systems“ am Aufbau und Betrieb der Telematikinfrastruktur der elektronischen Gesundheitskarte beteiligt. Nun haben Beschäftigte der Bertelsmann Stiftung einen Prototypen für eine elektronische Patientenakte entwickelt.
Ihre Wunsch-Version der elektronischen Patientenakte verspricht einen „Funktionsumfang: Plattform für digitale Prozessinnovationen“. Wie die Autoren weiter erläutern, soll der Prototyp „Systemakteuren ein erstrebenswertes Zukunftsszenario aufzeigen und sie zur Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen motivieren.“ Die angepeilten „Akteure“ sind also der Gesetzgeber, die Gematik und ihre Gesellschafter, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und vielleicht noch die mit der Umsetzung der Telematikinfrastruktur befassten Unternehmen. Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker usw. sind hingegen nur über ihre Spitzenverbände an der Festlegung der Rahmenbedingungen beteiligt – die Patienten überhaupt nicht.
Bei der Präsentation des Prototypen steht dennoch die Nutzung durch den Patienten im Vordergrund, für ihn soll die elektronische Patientenakte eine „umfassende Behandlungsmanagement-Plattform“ darstellen. Deren Möglichkeiten werden ausführlich hervorgehoben, mögliche Schadensrisiken hingegen nicht ausgelotet, was im Sinne einer ausgewogenen, patientenorientierten Betrachtung wünschenswert gewesen wäre.
Die Hervorhebung der souveränen Verfügung der Patienten über ihre elektronischen Akten macht durchaus Sinn – als Anreiz, die eigenen Daten innerhalb der Telematikinfrastruktur speichern zu lassen, bzw. selbst einzufüllen. Denn die elektronische Patientenakte nach SGB V ist freiwillig (zumindest derzeit noch – aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen wird für gesetzlich Krankenversicherte eine ärztliche Behandlung oder deren Abrechnung außerhalb der Telematikinfrastruktur in Zukunft möglicherweise nicht mehr machbar sein).
Und was hat die elektronische Patientenakte den Patienten nun wirklich zu bieten?
Die „digitale Prozessinnovation“ scheint im Wesentlichen darin zu bestehen, dass Interaktionen in die Akte verlegt werden: Anstatt mit dem Patienten zu sprechen oder einen Arztbrief an seinen Kollegen zu schreiben, markiert der Orthopäde im Röntgenbild die interessanten Stellen und hinterlegt die zugehörigen Informationen im Bild in der elektronischen Patientenakte. Der Patient fragt eine ärztliche Zweitmeinung online an und genehmigt gleichzeitig dem zweiten Arzt den Zugriff auf seine Akte. Statt einer Bewertung durch den Hausarzt werden dem Patienten Entscheidungshilfen eingeblendet. Und vermutlich wird auch die Entscheidung des Patienten im System dokumentiert und auf diesem Wege den Ärzten mitgeteilt – oder auch gleich online der Termin für die gewählte Behandlung angefragt…
Im weiteren Verlauf des Artikels merken die Autoren richtigerweise an, dass es entscheidend ist, wer mit welcher Berechtigung die in der Akte gespeicherten Informationen abrufen darf. Dazu haben sie in einem anderen Artikel in ihrem Blog „der digitale Patient“ bereits ein Tool vorgestellt, das es den Patienten ermöglichen soll, die Zugriffsregeln für ihre Ärzte und andere Mitglieder ihrer Behandlungsteams anhand einfacher Abfragen festzulegen. Dass bei der „Generierung der Zugriffspolicy“ diese Policy letztlich nicht unter der Kontrolle des Patienten ist, wird geflissentlich ausgelassen. Eine solche indirekte Generierung kann beispielsweise dafür sorgen, dass es dem Patienten nicht möglich ist, bestimmte Zugriffsrechte abzustellen.
Die so zustande gekommene Zugriffsregelung soll den Schutz der persönlichen Daten der Patienten gewährleisten. Lassen wir die Datenschutz- und Datensicherheitsproblematik für den Moment beiseite (dazu gibt es einige Artikel in diesem Blog) – auffällig ist, dass die Frage, wer mit welcher Berechtigung Daten in die Akte einspeisen darf, an dieser Stelle gar nicht erst gestellt wird.
Im vorgestellten Anwendungsbeispiel werden Daten erwähnt, die die Ärzte eintragen (z.B. die Erklärungen des Orthopäden zum Röntgen-Bild) und Informationen, die der Patient einfügt (z.B. das Schmerz-Tagebuch). Diese Fälle sind insofern unproblematisch, als die Eintragungen durch die jeweilige Rolle der Beteiligten gerechtfertigt sind. Dann aber „erscheinen“ weitere Informationen in Form der „Entscheidungshilfen“. Die Schöpfer des Prototypen bemerken hierzu: „Eine weitere kontextsensitive Einbindung hat enormes Wirkpotenzial: die passgenaue Platzierung leicht verständlicher und vertrauenswürdiger Gesundheitsinformationen.“ Sogar eine nutzerabhängige Steuerung der eingeblendeten Informationen ist denkbar: „Denkt man dieses Szenario weiter, könnte die Gesundheitsinformation oder Entscheidungshilfe sogar auf den Patienten zugeschnitten sein – indem zum Beispiel dessen Alter, Geschlecht oder Vorerkrankungen berücksichtigt werden.“
Hier wäre es interessant zu wissen, wer mit welcher Berechtigung diese Daten einspeist und wie ggf. eine Nutzerabhängig unterschiedliche Auswahl der angezeigten Information geregelt ist. Wenn sich nämlich die Patienten nicht mehr aufgrund ärztlicher Beratung, sondern anhand solcher „Entscheidungshilfen“ für oder gegen Behandlungsformen entscheiden, wäre es nur folgerichtig, wenn sich das Tätigkeitsfeld von Pharma-Referenten und anderer Verkäufer und Lobbyisten entsprechend verlagerte. Wer die „Entscheidungshilfen“ der elektronischen Patientenakte programmiert, könnte sich vermutlich von Pharmafirmen, Anbietern von Heil- und Hilfsmitteln oder diverser Therapien die Tastatur vergolden lassen.