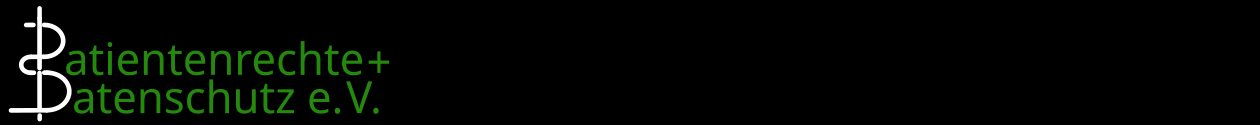Am 25.09.2017, unmittelbar nach der Bundestagswahl hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zwei Stellungnahmen veröffentlicht mit den Titeln
– Positionen der KBV zur Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung
– Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte.
Am 27.09.2017 wurde zudem der Letter of Intent zur Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen digitalen Agenda, eine gemeinsame Stellungnahme der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) und der KBV veröffentlicht.
Erkennbar versucht die KBV, mit diesen Stellungnahmen auf die in den Wochen vor der Wahl erneut aufgebrochene Diskussion um die Zukunft der elektronischen Gesundheitskarte (eGk) und die Zukunft der gematik zu reagieren und auf die Inhalte der Koalitionsvereinbarung im Bund Einfluss zu nehmen.
Für alle gesetzlich Versicherten, denen an Patientenrechten und Datenschutz gelegen ist, ein Anlass, um diese Stellungnahmen einer Überprüfung zu unterziehen.
Um mit dem Positiven zu beginnen: In den „Positionen der KBV zur Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ (Punkt 5) wird festgestellt: „Grundvoraussetzung für die KBV ist, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt bzw. Psychotherapeut und Patient auch in einer digitalen Welt erhalten bleibt: Eine Datenweitergabe darf nur freiwillig und nur mit Zustimmung des Patienten erfolgen.“ So weit, so richtig. Wünschenswert wäre aber eine klare und eindeutige Absage der KBV an die immer wieder geäußerten Begehrlichkeiten, mit sogenannten Opt-out-Lösungen wie z. B. in den EU-Staaten Dänemark, Estland und Österreich den millionenfachen Zugang zu Gesundheits- und Patientendaten zu ebnen.
Positiv auch die Feststellung in den „Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“ (Punkt 3): „Die Betreiber der ePA müssen sorgsam und im Sinne des Patienten mit den personenbezogenen Daten umgehen. Dies setzt voraus, dass die Betreiber kein wirtschaftliches Interesse an den in der ePA gespeicherten Daten haben…“
Problematisch ist allerdings die Forderung der KBV nach der gesetzlichen Festlegung, dass jede/r Versicherte nur eine elektronische Patientenakte haben darf, die von einem Anbieter innerhalb der Telematik-Infrastruktur der gematik bereitgestellt werden muss („Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“, Punkt 7.):
„Die Regelungen in § 291a des Fünften Sozialgesetzbuchs sehen eine bundesweite patientenzentrierte Akte vor. Weitere Insel- oder Parallellösungen für patientenzentrierte Gesundheitsakten sind daher auszuschließen. Hierfür brauchen wir die Unterstützung des Gesetzgebers, um die gesetzlichen Regelungen dahingehend zu überarbeiten und zu bereinigen (z. B. § 68 SGB V). Es sollte sichergestellt werden, dass jeder Patient nur eine ePA hat. Ein Anbieterwechsel (inkl. seiner Daten) sollte für den Patienten dennoch jederzeit möglich sein.“
Die gewünschte Änderung von § 68 SGB V (Finanzierung einer persönlichen elektronischen Gesundheitsakte) zielt darauf ab, die von TK, AOK und anderen begonnenen Pläne für kassenspezifische elektronische Patientenakten zu beenden.
Der Verein Patientenrechte und Datenschutz e.V. vetritt den Standpunkt, dass jeder Versicherte die freie Wahl haben muss, ob er eine elektronische Patientenakte möchte, wieviele Akten er anlegt oder anlegen lässt und wo diese gespeichert werden sollen.
Monopolistische Strukturen müssen verhindert werden. Es darf für Ärztin oder Arzt nicht offensichtlich sein, ob es ein, zwei oder keine elektronische Akte über die Patientin oder den Patienten gibt. Nur durch die unbedingt erforderliche Mitwirkung der Patientin oder des Patienten beim Identifizieren seiner oder ihrer Akte ist ein Recht auf keine verpflichtende, lebenslange Akte zu sichern. Daher muss es zulässig sein, dass eine Patientin oder ein Patient mehrere elektronische Patientenakten bei Anbietern eigener Wahl anlegen lässt. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass Patientin oder Patient auch eine dezentrale digitale Akte auf einem eigenen Gerät nutzen kann.
Die Gematik sollte nicht von den Verbänden im Gesundheitswesen kontrolliert werden, sondern eine staatliche Bundesanstalt sein. Sie sollte keine eigenen Betriebs-Aufträge vergeben, sondern Dienstleister kontrollieren und Produkte normieren.
Als Anbieter von technischen Infrastrukturen sollten neben Privatunternehmen auch Krankenkassen, Ärzteverbände oder ihre Tochterunternehmen zugelassen werden.
Außerdem fordert die KBV, dass „der Gesetzgeber vom Zwei-Schlüssel-Prinzip abweicht. Zum einen sollte es dem Patienten auch ohne Anwesenheit des Arztes möglich sein, seine ePA einzusehen und zu verwalten. Zum anderen sollte der Arzt entsprechend der erteilten Zugriffsrechte Dokumente in Abwesenheit des Patienten in die ePA einstellen und einsehen können. Hier bietet es sich zudem an, dass ein Arzt definierte Aufgaben an qualifizierte Praxismitarbeiter delegieren kann.“ („Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“ (Punkt 2.)
Das Zwei-Schlüssel-Prinzip besagt, dass ein Zugriff auf die ePA nur möglich ist, wenn Heilberufsausweis des Arztes und eGK des betreffenden Patienten gleichzeitig gesteckt sind. Die Abweichung von diesem Prinzip in der von der KBV vorgeschlagenen Form ist abzulehnen. Patientenakten sollten von Patientinnen und Patienten – und nur von ihnen oder in ihrem Auftrag – verwaltet werden. Patientinnen und Patienten sollten den vollen Zugriff auf alle Bereiche der ePA haben und z.B. die Datei einzelner Behandler komplett löschen können. Wenn ein Arzt im Auftrag für Patientinnen und Patienten Daten in die Akte schreibt oder ändert, muss rechtlich und technisch sichergestellt werden, dass das nicht ohne Zustimmung der Patientinnen und Patienten zulässig und – falls die Patientinnen und Patienten das wollen – auch nicht möglich ist.
Eindeutig negativ zu bewerten ist die allen KBV-Papieren durchscheinende unkritische Position der KBV zu dem im SGB V vorgegebenen und von der gematik umgesetzten zentralisierten System der telematischen Infrastruktur des Gesundheitswesens.
Wenn in den „Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“ (Punkt 1.) festgestellt wird, dass
– die ePA „weder die Primärdokumentation des Arztes noch die bereits etablierte Arzt-Arzt-Kommunikation, beispielsweise im Rahmen von Befundübermittlungen oder Entlassbriefen“ ersetzen kann,
– Ärzte „keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten in der ePA übernehmen“ können und
– aus forensischen Gründen „der Umfang der dem Arzt vom Patienten freigegebenen Daten im Praxisverwaltungssystem revisionssicher zu dokumentieren“ ist,
drängt sich die Frage auf, warum dann noch eine ePA notwendig sein soll.
Auch wenn in Punkt 8 der „Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“ festgestellt wird, dass eine ePA „nicht eine unter ärztlicher Hoheit geführte e-(Fall-)Akte ersetzen“ kann muss die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer ePA gestellt werden, was die KBV leider nicht tut. Dafür und ggf. parallel für Patientenakten einzelner Krankenkassen weitere hunderte von Millionen an Versichertengeldern zu verschleudern und Konzernen der Gesundheits-IT oder Startups in den Rachen zu werfen, macht aus Sicht von Versicherten keinen Sinn.
Den Nutzen der ePA verortet die KBV dementsprechend in den Höhen des Abstrakten: „Das Potenzial der ePA liegt damit insbesondere darin, den Arzt-Patienten-Dialog zu verbessern. Außerdem stärkt sie die informationelle Selbstbestimmung des Patienten.“ (vgl. Einleitung der „Positionen der KBV zur elektronischen Patientenakte (ePA)“)
Dass es den Dialog zwischen Arzt und Patient verbessert, wenn der Arzt die Akte konsultiert anstatt den Patienten zu fragen, und zusätzliche Zeit für Datenerfassung aufwenden muss, ist kaum vorstellbar. Der Patient kann dann zwar möglichweise in der Akte nachlesen, was der Arzt ihm aus Zeitgründen nicht erklären konnte, aber auch das verbessert sicherlich nicht den Dialog. Ebensowenig ist nachvollziehbar, inwiefern die ePA die informationelle Selbstbestimmung stärken könnte – insbesondere, da der Patient nach derzeitigem Stand in der eigentlichen Akte keine Schreib- und Löschrechte hat.