Am 17. April 2018 hielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Rede zur Eröffnung der Branchen-Messe conhIT (als Video verfügbar). Dabei bekräftigte er, die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben zu wollen. Das Gesundheitswesen, so der Minister, sei hoch reguliert und böte daher innovationsfreudigen Unternehmen nicht genug Freiräume für Gestaltung und Experimente. Insbesondere der Datenschutz wirke als ewiger Verhinderer – wie er bereits vor Jahren als Co-Autor eines einschlägigen Buches festgestellt habe: „Die etwas provokante These unseres Buch damals war ja „Datenschutz ist was für Gesunde“. Das würde ich so einfach formuliert… darf ich sowas als Minister gar nicht mehr sagen, also vergessen Sie es gleich wieder. Aber, was wir meinen damit, ist, dass übertriebene – darum geht es ja – übertriebene Datenschutzanforderungen an bestimmten Stellen effizientere Versorgung zum Beispiel verunmöglichen. Oder auch die Frage, wie man Dinge tatsächlich aus Patienten-, aus Ärzte-, Apotheker- und Pflegesicht besser gestalten kann. Selbst mit Einwilligung desjenigen, um dessen Daten es hier geht.“ (Der letzte Satz lässt die Erfordernis der Einwilligung des Patienten doch eher wie ein Ärgernis wirken…)
Anschließend nennt Spahn drei Punkte, bei denen er ansetzen möchte: Verbesserung der Versorgung, Big Data-Forschung mit Versorgungsdaten und Zertifizierung für Gesundheits-Apps.
Verbesserungen bei der Versorgung – auch in strukturschwachen ländlichen Gebieten – verspricht sich Spahn von Telemedizin und Effizienzsteigerung durch Digitalisierung.
Auch die Forschung mit Patientendaten betrachtet Spahn als lösbares Problem: Die Daten seien ja alle vorhanden, man müsse nur mit Hilfe künstlicher Intelligenz „pseudonymisiert und anonymisiert hunderttausendfach“ Behandlungsverläufe auswerten, um neue – auch individualisierte – Therapien zu entwickeln. Hinderlich dabei ist wiederum die Erfordernis der Einwilligung der betroffenen Patienten, auch wenn Spahn betont: „Natürlich – immer soll der Patient Souverän sein dessen, was mit seinen Daten passiert.“ Der Minister ist jedoch zuversichtlich, dass sich genug Freiwillige finden werden, die die gewünschte Forschung durch „Datenspenden“ ermöglichen.
Dieser Ansatz zur Versorgungsforschung ist jedoch in mehrerlei Hinsicht zutiefst problematisch.
Zunächst einmal: Eine Anonymisierung so individueller Datensätze wie Patientenakten ist nicht zuverlässig möglich, solange der Personenbezug erhalten bleibt. (Eine Anonymisierung durch die Aggregation der Daten vieler Personen würde funktionieren, aber zugleich die Verfolgung individueller Krankheitsverläufe unmöglich machen.) Bei Erhaltung des Personenbezugs handelt es sich also nur um eine Pseudonymisierung. Und wie Wissenschaftler aus den USA und Dänemark herausfanden, lässt sich eine Pseudonymisierung rückgängig machen, wenn man genug Vergleichsdaten hat: In einer Studie konnten die Forscher Kreditkartendatensätze zu 90% den tatsächlichen Karteninhabern zuordnen, sofern sie Ort und Datum von vier Einkäufen kannten (Studie „Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit card metadata“, siehe Zusammenfassung auf netzpolitik.org und Bericht in der Zeitschrift „Science“ vom 30.01.2015). Für Patientenakten dürfte eine ähnliche Deanonymisierungsquote z.B. mithilfe weniger bekannter Arzt- oder Apothekenbesuche zu erreichen sein.
Auch dass Spahn den Patienten als „Souverän“ seiner Daten bezeichnet, ist nicht gerade beruhigend: Die sog. „Datensouveränität“, die von immer mehr Politikern und interessierten Unternehmen propagiert wird, ist ein Gegenkonzept zum bisherigen, grundrechtlich garantierten Datenschutz.
Bislang gilt: Laut Grundgesetz genießen die Würde des Menschen und seine daraus abgeleiteten Grundrechte (darunter die Privatsphäre) voraussetzungslosen Schutz. Grundrechte sind Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat, sie wurden nach den Erfahrungen des Dritten Reiches in der Verfassung verankert. Sie dienen auch als Schutz gegen die Entwürdigung, als Mensch Nützlichkeitsüberlegungen unterworfen zu werden.
Das Konzept der „Datensouveränität“ hingegen erklärt Daten zum „Eigentum“ des Patienten – und damit zum veräußerbaren Gegenstand. Die logischen Konsequenzen dieser Umdefinition sind offensichtlich: Eigentum kann verkauft, gestohlen, aufgrund fadenscheiniger Klauseln übereignet oder auch „im Interesse der Allgemeinheit“ enteignet werden. Darüber hinaus würde diese Sichtweise Patientendaten und medizinische Behandlungen für Nützlichkeitsabwägungen öffnen – z.B. im Sinne der vom australischen Philosophen Peter Singer vertretenen „Praktischen Ethik“ mit dem Ziel einer „Gesamtnutzen-Maximierung“.
Wenn dem keine von der Verfassung garantierten, unveräußerlichen Grundrechte des Einzelnen entgegenstehen, kann natürlich auch mit Kosten argumentiert werden (z.B. wäre abzuwägen, inwieweit die Hüftgelenksoperation von Frau Meier (69) zur „Gesamt-Gesundheit“ beiträgt und ob man das Geld nicht anders verwenden sollte. Oder vielleicht möchte sich Frau Meier die Operation mit der Teilnahme an einer Studie erkaufen?).
Diese Öffnung für utilitaristische Ansätze stellt logischerweise auch die von Spahn hervorgehobene Freiwilligkeit der „Datenspende“ in Frage, denn ein größerer Gesamtnutzen würde ja die zwangsweise Requirierung der benötigten Daten rechtfertigen.
Jens Spahn sollte bedenken: Wer freiwillige „Datenspenden“ wünscht, sollte auf den grundrechtlichen Schutz der Daten setzen, nicht auf ein als „Datensouveränität“ beschönigtes „Eigentumsrecht“. Nur bei grundrechtlichem Schutz können sich Datenspender darauf verlassen, dass sie ihre Einwilligung notfalls auch widerrufen können und dass die betreffenden Stellen – zumindest die rechtstreuen – ihre Daten dann auch löschen werden. Wenn die „Datenspende“ hingegen rechtlich als Übertragung von Eigentum gälte, hätte der „Spender“ keinen Einfluss mehr auf die weitere Verwendung seiner Daten und auch keine Möglichkeit zum Widerruf. Unter diesen Umständen könnte man von „Datenspenden“ nur abraten.
Nun möchte man dem Bundesgesundheitsminister bei seinen Plänen nicht von vorne herein bösen Willen unterstellen – unreflektierter Aktionismus ist jedoch genauso gefährlich.
Wir wünschen Herrn Spahn gute Besserung und hoffen, dass er bald aufhört, verfassungsmäßige Grundrechte erkrankter Menschen in Frage zu stellen.
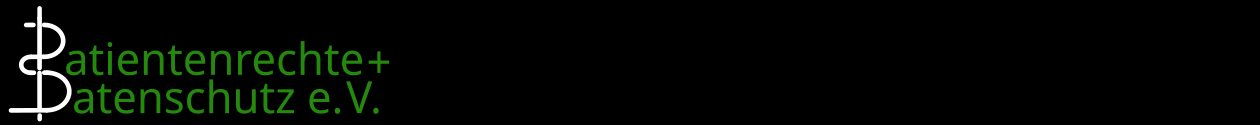
„Datenschutz ist was für Gesunde“ und „Das würde ich so einfach formuliert… darf ich sowas als Minister gar nicht mehr sagen, also vergessen Sie es gleich wieder.“, so Jens Spahn am 17.04. auf der ConHIT – Diese Aussagen entlarven den Minister Spahn für was er steht !!
Es geht hier nicht um die „freiwillige Datenspende“ für die „Volksgesundheit“, auch nicht um Gesundheitsdaten als Eigentum des Patienten.
Es geht hier ganz klassisch um die Abschaffung des Menschen als Individuum mit seinen unveräußerlichen Rechten wie sie im Grundgesetz verankert sind. Der Mensch ist für Spahn „entpersonalisiert“, er ist nur noch eine Hülle mit einem Zahlencode versehen, ein Datencontainer der beliebig befüllt und bearbeitet werden muss. Die entsprechenden Gesetze (bspw. e-Health-Gesetz II) werden auf den Weg gebracht.
Die millionenfachen Ängste der Bürger gegen die Datensammelwut im Gesundheitssektor werden trotz täglich auftretender Cyberkriminalität negiert, nach dem Motto: Der Staat (hier: die Herrschenden in einem Politik-System) weiß am Besten was für den Bürger gut ist.
Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass „Digital gesund macht“. Vielmehr ist es eher so, dass nicht erst seit dem Cambridge-Analytica-Skandal eine Depression sich breit macht , die sich ebenso auf das Verwalten der „eigenen“ Gesundheitsdaten in welcher Form auch immer auswirkt. Der Rückzug auf die private, schützende und vertraute Umgebung mit persönlichen Kontakten zu Menschen die man schätzt und lieb gewonnen hat, ist dann die Therapie die anschlägt – und nicht der weltweite Wahn mit digitalisierten Gesundheitsdaten.